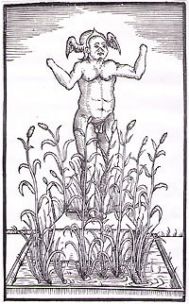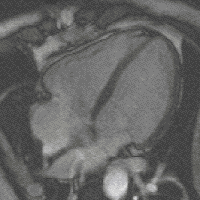Adolf v. Grolman: JOHANN SEBASTIAN BACH
Grolmans Kindheit und Jugend war wesentlich bestimmt von Musik: Früh und anhaltend erlernte und spielte er Geige, Klavier und Orgel. Nach einer Promotion in Rechtswissenschaft studierte Adolf v. Grolman (1888-1973) Literaturwissenschaft, Geschichte und Kunstgeschichte. Seine Dissertation über Friedrich Hölderlins Hyperion wurde 1919 veröffentlicht. Im gleichen Jahr wurde er an der Universität Gießen habilitiert. Die Inflation zu Beginn der 20er Jahre führte zum Verlust seiner Einkünfte und des Vermögens. Er mußte seine Position als Privatdozent aufgeben und wurde – für den Rest seines Lebens – freier Schriftsteller. Seine umfangreiche Bibliografie enthält Monografien und Sammelbände, Aufsätze, Rezensionen, Herausgeberschaften, Einleitungen und Nachworte.
1944 erscheint (in Nideggen/Eifel, als letzte Veröffentlichung des in Berlin bereits ausgebombten Verlages Lambert Schneider) Grolmans Monografie Leonardo da Vinci, 1946 am neuen Standort des Verlages, Heidelberg, zwei literarische Werke: Ferien. Ein Roman und Karlsruher Novellen, 1948 dann das hier wiederveröffentlichte Buch zu Johann Sebastian Bach.
In seinem nicht an musikwissenschaftlichen Kriterien, sondern radikal und provokant an dem eigenen hermeneutischen Zugang zu Bach orientierten Buch skizziert der Autor die Umwälzung im Bereich von Musik, Religiosität, auch im Zusammenhang mit der "Aufklärung" (wie Grolman sie sieht), die zu Bachs Zeit beginnt. Musikgeschichtliche Tatsachen werden dabei innig verknüpft mit abwertenden Beurteilungen der musikalischen Produktion speziell der Wiener Klassik. Grolman stellt dies alles so unprätentiös, ehrlich, fast naiv dar, daß wir verstehen lernen können, wie grundlegende Einstellungen zu kulturellen Zusammenhängen zustandekommen können.
Adolf v. Grolmans Verständnis von JSB beruht auf der Selbstverständlichkeit des Autors, daß "unser ganzes Leben ein Dienst vor Gott ist". Leser*innen, die nicht "an Gott glauben", müssen dieses Axiom immerhin mitdenken im Bemühen, Grolmans Überlegungen gerechtzuwerden und dadurch eventuell Bach gerechtzuwerden, für den es zweifellos genauso galt. Zu vermuten ist, daß der christliche Glaube zu Bachs Zeit für eine Mehrheit von Menschen (in Mitteleuropa) alltäglich bedeutsame religiöse Lebenshaltung war – aus der die Menschen Orientierung, Lebensmut und andere Ressourcen bezogen haben.
Wenngleich wir wohl Grolmans rigorosen Anspruch einer hermeneutischen Identifikation mit Bachs musikalischem Ausdruck spiritueller Erfahrungen kaum teilen können, läßt sich gleichwohl sein Buch selbst als Ausdruck von Grolmans eigener Annäherung an das "Wirklichkeitsganze" achten.
Bedenkenswert sind von Grolman dargestellte Facetten des Protestantismus, zwischen denen Bachs kompositorisches Schaffen sich entwickelte. Im Mittelpunkt steht hierbei die subtile Bedeutung des Pietismus und der lutherischen Orthodoxie für Bachs religiöse und kompositorische Entwicklung. Ein anderer Schwerpunkt sind ausführliche Erläuterungen zum Aufbau einzelner Kantaten in ihrer Verbindung von Choraltext, Rezitativtext, Choralmusik und Rezitativ sowie die Bedeutung des Chorals (vor Bach und noch bei Bach) in seiner integralen Verbindung von Text und Melodie. Hier kann die Lektüre dazu ermuntern, Grolmans Erläuterungen (oder Behauptungen) anhand diskutierter Choräle oder Kantaten zu überprüfen. Faszinierend war für mich (trotz, vielleicht auch nur wegen meiner fachlichen Inkompetenz) Grolmans Darstellung von Bachs Umgang mit Fugenthemen – zu verschiedenen Lebensphasen.
Der Autor assoziiert kulturelle Ereignisse unterschiedlicher Gattungen, Musik, Gemälde, Literatur miteinander und interpretiert sie und ihre Zusammenhänge nach seinem eigenen Maßstab, den er kaum begründet; an egal welchen Wissenschaften orientiert er sich kaum je. Für Grolman zählt letztlich nur die Kompetenz von Künstlern: Komponisten, Musikern, Bildenden Künstlern, Architekten. Auch im Umkreis von Theologie, Philosophie, Literaturwissenschaft diskutiert er gelegentlich Auffassungen einzelner Vertreter, ohne sich mit theoretischen Ableitungen zu befassen. Grolmans Maßstab ist letztlich immer nur seine eigene Auffassung, seine eigene Wahrheit, Erkenntnis und Meinung. So sollten Grolmans Werke vermutlich ausnahmslos als literarische, essayistische Arbeiten gelesen werden.
Grolmans rigoroser Identifikation mit JSB entsprangen nicht nur einige idiosynkratische Behauptungen, die wohl niemand ernst nehmen kann, sondern auch – vor allem – tiefgründige Hinweise oder Vermutungen zu Bachs Intention und Bedeutung seiner Musik, um deretwillen mir die Wiederveröffentlichung dieses Buches von 1948 wichtig ist.
Zur Neuausgabe hinzugefügt wurden etliche historische Abbildungen Bachs (die allermeisten entstanden nach Bachs Tod), ein Bild des Autors, ein Aufsatz Theodor W. Adornos, ein Beitrag einer Bachtagung in Leipzig (1950) sowie Hörempfehlungen (mit Literaturhinweisen, Links und Filmen).
(Aus dem Nachwort)
Ebenfalls bei A+C wiederveröffentlicht wurde die Monografie von Walter Vetter: Der Kapellmeister Bach. Versuch einer Deutung Bachs aufgrund seines Wirkens als Kapellmeister in Köthen.
auc-188-grolman-bach (pdf 4,1 MB)