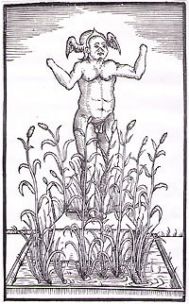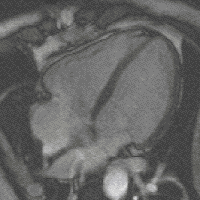Imre KESZI: Regression & Utopie. Ein Roman für Richard Wagner
Der ungarische Schriftsteller Imre Keszi (1910 – 1974) war Kritiker, Musikwissenschaftler, Übersetzer, Lehrer, Universitätsprofessor. Er studierte an der Universität Budapest und zugleich an der Musikakademie, dort Schüler Zoltán Kodálys. Er schrieb Kurzgeschichten und mehrere Romane.
Keszi kam aus einer jüdischen Familie. Nach 1945 trat er umgehend der neugegründeten Ungarischen Kommunistischen Partei bei.
Sein Roman ELYSIUM (1958) gilt als erstes ungarisches episches Werk zum Thema der Judenvernichtung. Es wurde auch ins Deutsche übersetzt.
Der hier erstmalig auf Deutsch wiederveröffentlichte Roman A VÉGTELEN DALLAM. RICHARD WAGNER ÉLETREGÉNYE (1963) erschien 1984 in der DDR. Der dem ungarischen Original gleichlautende Titel war UNENDLICHE MELODIE. LEBENSROMAN RICHARD WAGNERS.
Keszis Buch ist im Grunde das Hybrid einer Romanbiographie mit essayistischen Passagen. Daran hat sich der Titel für diese Neuausgabe orientiert: Regression und Utopie – das sind bedeutsame Blickwinkel auf Wagners Lebensbewegung sowie seine innersten Intentionen, wie (auch) in Keszis Buch nachvollziehbar wird. – Und es ist, meine ich, deutlich ein Buch der (kritischen) Zuneigung zu Wagner und seinem Werk: ein Roman für Wagner.
Im Mittelpunkt des Buches steht Wagners persönliche und kreative Selbstentfaltung in ihrer polyvalenten Zwiespältigkeit. Bei jeder umfassenderen Beschäftigung mit diesem Komponisten, seinem Werk, mit seinem Leben und der Literatur über ihn wird die Vielzahl der Aspekte, der möglichen Blickwinkel auf die Wahrheit Richard Wagners offensichtlich. Nicht von ungefähr füllt die Literatur darüber Bibliothekswände. Imre Keszi gelingt es, diesen Umstand sinnlich, episch zu vermitteln. Dazu gehört die Ahnung, daß diese Blickwinkel, diese Stimmen und Teilwahrheiten nicht selten miteinander fast unvereinbar zu sein scheinen.
Momente einzelner musikalischer Werke werden von dem ausgebildeten Musiker Keszi (d.h. seinem Alter Ego Glasius) vorgestellt und interpretiert. Zweifellos bedeutete das Buch nicht zuletzt die Auseinandersetzung des Autors Keszi mit Wagner und seinem Werk. Dadurch beschenkt er uns mit vielen einzelnen Überlegungen, die sich nachvollziehbar entwickeln aus dem Standort einzelner Personen und die uns zu neuer Aufmerksamkeit für Wagners Werk einladen.
Verblüffend ist der hautnahe Bericht des fiktiven Protagonisten Franz Glasius, der bei aller Nuanciertheit erfrischend alltäglich bleibt. Jeder Anspruch an literarische oder musikologische Ausgefeiltheit scheint zu fehlen. Dieser Duktus verführt (zumindest mich) dazu, den erwähnten Personen und Vorkommnissen unbefangen im Netz und in der Literatur nachzuspüren ... nicht der schlechteste Einfluß eines biografischen Romans. Verbindungen, Interdependenzen zwischen biographischen Momenten und künstlerischer Gestaltung in Musik werden von "Glasius" verdeutlicht (oder auch nur vermutet). Nirgendwo versucht der Autor (Dr. Glasius), in der Darstellung eine Kohärenz der Persönlichkeit Wagners zu erzwingen: immer kommt im nächsten Absatz oder Kapitel wieder das ganz Andere! Dabei empfinde ich oft eine geradezu musikalisch ausgewogene Gewichtung der einander folgenden Blickwinkel. Die Vielschichtigkeit und Komplexität der Handlung korrespondiert mit der Vielschichtigkeit des Themas, gleichwohl bewahrt das Buch bis zuletzt seinen Zusammenhang, seine Dichte.
Keszis Buch nimmt uns die Entscheidung nicht ab, ob wir in Wagner den genialen Komponisten sehen wollen oder aber den musikalischen Schaumschläger, den narzißtischen, vielleicht gar antisemitischen Eigentlich-gar-kein-Komponisten. Der Essay-Roman löst dieses bis heute landläufige Entweder/Oder auf in eine Vielzahl von gleichermaßen bedenkenswerten Blickwinkeln, Aspekten, Hinweisen, Ahnungen. Und dennoch kann er uns dabei helfen, einen eigenen Standpunkt zu Wagner und seinem Werk zu finden … natürlich auf Grundlage der Musik selbst.
Wagners erste Ehefrau Minna Planer ist zweifellos die dritte Hauptfigur dieses Romans. Deutlich ist die (kritische) Sympathie des Autors (und seines Alter Ego Glasius) für sie, jedoch gab es 1963 erst wenig Forschungsliteratur zu ihrer Persönlichkeit und ihrer Bedeutung für RW. Über die fiktive Beziehung zwischen Minna und Dr. Glasius konnte der Autor jedoch seine Mutmaßungen zu Minnas Empfinden, ihren Fähigkeiten, dem persönlichen Lebenskampf (und dem Kampf um RW), ihrem Leid und den sozialisationsbedingten Engen ihrer Persönlichkeit einbringen.
Im Anhang der Neuausgabe werden Auszüge aus den Tagebüchern des bedeutenden Theaterleiters Eduard Devrient dokumentiert, der mit Wagner viele Jahre in engem beruflichem Austausch stand, weiterhin ein Interview mit dem Opernregisseur Harry Kupfer sowie zwei Aufsätze des Sozialphilosophen und Musiksoziologen Theodor W. Adorno.
auc-194-keszi-wagner (pdf 2,6 MB)