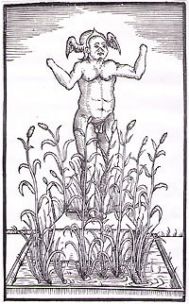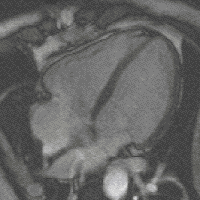Mary Jane Ward: SCHLANGENGRUBE
Die amerikanische Schriftstellerin Mary Jane Ward (1905–1981) war 1939/40 Patientin einer psychiatrischen Klinik. Auf der Grundlage ihrer Erfahrungen dort schrieb sie den hier wiederveröffentlichten Roman THE SNAKE PIT (1946). Die Veröffentlichung löste in der amerikanischen Öffentlichkeit, auch unter Psychiatern und Gesundheitspolitikern, lebhafte Reaktionen aus. Das Buch und ein nach ihm gedrehter Spielfilm führten in mehreren Staaten der USA zu Reformen der psychiatrischen Unterbringung und Behandlung. In Großbritannien wurde der Film erst nach einigen Schnitten zugelassen. In der BRD gab es keine nennenswerte öffentliche Reaktion.
Die Autorin vermittelt uns einen nuancierten, oft tief berührenden Einblick in die Erfahrungen und das Empfinden einer Frau des amerikanischen Mittelstands, die es in den 40er-Jahren des 20. Jahrhunderts in eine "Irrenanstalt" verschlägt. Jenseits psychiatrischer Begrifflichkeit werden Momente psychotischer Verwirrung und Verlorenheit im kontinuierlichen (aber gebrochenen) Bewußtseinsstrom der Protagonistin deutlich. Unaufdringlich werden im Fluß der Handlung die kommunikativen Verknotungen, Verwirrungen zwischen psychiatrischen Patientinnen und "den Gesunden" vermittelt. Unangemessene, unsensible Kommunikationsweisen gerade in einem psychiatrischen Krankenhaus, wo Betroffene sich fachliches Verständnis versprechen, führen zur iatrogenen Zerstörung des Selbstwertgefühls – damals wie heute! Psychiatrische PatientInnen sind sich ihrer Symptomatik zeitweise durchaus bewußt. In der unsicheren Einschätzung des Grads der eigenen Gesundheit oder Krankheit schämen sie sich, versuchen kognitive Defizite zu verbergen vor anderen (insbesondere den Ärzten), sie zu rationalisieren. Nicht selten fühlen sie sich den Ärzten und klinischen Psychologen gegenüber wie SchülerInnen, die verbergen wollen, daß sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben.
Daß die paranoiden, halluzinatorischen, wahnhaften Verkennungen in der Psychose um nichts weniger evident sind als Eindrücke im nichtpsychotischen Zustand, daß in der Psychose beides in vielfältiger Abstufung ineinander übergeht, Minute für Minute, läßt sich gerade in diesem romanhaften Bericht besonders gut nachvollziehen, weil es hier durchgängig um alltägliche Umstände und Klärungsprozesse geht, – nicht um ausufernde psychotische Phantasien, wie sie üblicherweise als Beleg für das angeblich Nichteinfühlbare der Psychose angeführt werden. Deutlich wird auch, wie leicht es ist, psychiatrische PatientInnen zu verfehlen, wenn wir nur nach psychotischen Symptomen Ausschau halten und die alltäglichen Lebenserfahrungen vernachlässigen.
Bei allen kritischen, sarkastischen und ironischen Bemerkungen porträtiert die Protagonistin ihre Mitpatientinnen im allgemeinen achtungsvoll, mit soviel Einfühlung, wie sie aufbringt. Oft läßt sie uns deren Einsamkeit und die individuellen Kompensations- und Rationalisierungsversuche nachfühlen. Die ganz eigene Authentizität von PsychiatriepatientInnen stellt sie mehrfach der sozialen Normalität der Außenwelt gegenüber, wobei diese keineswegs besser abschneidet. Selbst ihrem eigenen Gesundungsprozeß steht Virginia gelegentlich ambivalent gegenüber: "Ich nähere mich dem Nichtpatientenstatus. Mein Mitgefühl verliert sich. Meine Sympathie. Ja, und meine Großzügigkeit …"
Trotz der unterschiedlichen Ausgangslage läßt sich dieser romanhafte Bericht in vielem auf die heutige stationäre Psychiatrie übertragen, auch im Hinblick auf die instititutionellen und sozialen Umstände der Betreuung.
(Aus dem Nachwort)