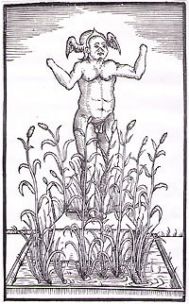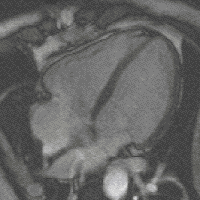Paula Judith Buber: AM LEBENDIGEN WASSER
Paula Winkler (1877–1958) stammte aus eine gutbürgerlichen katholischen Beamtenfamilie in München. 1899 lernte sie beim Germanistikstudium in Zürich den Kommilitonen Martin Buber kennen (später ein bedeutender jüdischer Religionsphilosoph und Mitbegründer einer dialogischen Pädagogik und Psychologie). 1901 trat sie aus der katholischen Kirche aus. 1906 zogen Paula und Martin nach Berlin. Dort konvertierte Paula im Januar 1907 zum Judentum, was die Heirat mit Martin Buber ermöglichte. (In diesem Zusammenhang nahm sie den zusätzlichen Vornamen Judith an.) Seit 1912 veröffentlichte sie unter dem Pseudonym Georg Munk Erzählungen sowie Romane. (Zwei ihrer drei Romane wurden 2008/9 in Buchhandelsausgaben wiederveröffentlicht.) 1916 zog die Familie (mit Sohn und Tochter) von Berlin nach Heppenheim (unweit von Heidelberg).
1935 wurde Paula Buber wegen "jüdischer Versippung" aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen. Im März 1938 emigrierte die Familie Buber nach Palästina, wo Martin Buber einen Lehrstuhl an der Hebräischen Universität Jerusalem übernahm. In den folgenden Jahren wurde ihr dritter Roman AM LEBENDIGEN WASSER abgeschlossen, an dem die Autorin seit etwa 1925 gearbeitet hatte.
AM LEBENDIGEN WASSER erschien erst 1952 in einer einzigen Auflage von 5000 Exemplaren im Insel-Verlag (Wiesbaden).
Der Roman ist die Utopie einer menschengemäßen familiären Gemeinschaft über die Generationen, in der seelische (und soziale) Entfremdung einen sehr geringen Stellenwert hat. Aber ist das überhaupt vorstellbar? Sind wir doch alle eingesponnen in vielfältige Selbstverständlichkeiten von Entfremdung (Verdinglichung). Zugrunde gelegt wird von Paula Buber dieser Utopie die Annahme einer wesentlich durch Frauen getragenen zivilisatorischen Wirkmächtigkeit, wie sie heutzutage im Rahmen von Anthropologie und Gendertheorie eher infrage gestellt wird.
In jedemfall erinnert uns die Autorin an Schätze, die Menschen einander schenken können: immaterielle (Achtsamkeit, Liebe, Geduld, Rücksichtnahme) – aber auch materielle, die wiederum immaterielle Werte bewahren können (Erinnerungen, Dankbarkeit, Schönheit, Bindung, Trost). Aber materielle Schätze werden zerstört durch Kriege und das Gewinnstreben von Erben, die die entsprechenden Dinge verkaufen. Immaterielle Werte werden zerstört durch seelische Entfremdung, Schicksalsschläge, Trägheit des Herzens ...
Der Roman beginnt etwa 1875 und endet mit der Revolution 1919. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln einzelner Familienmitglieder werden im Verlauf des Buchs Lebensverläufe skizziert, wodurch das vitale Geflecht der "Sippe" vorstellbar wird. Nachfühlbar wird das Mitleben, Fortleben und Weiterleben zwischen Familienmitgliedern aufeinander folgender Generationen. Dabei gibt es auch in dieser exzeptionell humanisierten Großfamilie erhebliche zwischenmenschliche Unvereinbarkeiten, ideologische Fremdheiten, seelische Verletzungen, Konflikte, auch Kindheits-Traumatisierungen. Innerhalb der Großfamilie werden etwa ebensoviele uneheliche Verbindungen (einschließlich "Ehebruch" und Dreiecksbeziehungen) wie eheliche dargestellt. – Jedoch wird mit all dem anders umgegangen, als wir es wohl zumeist erleben! Schicksalsschläge werden in der von Buber imaginierten familiären Gemeinschaftlichkeit offenbar generell nicht explizit, gemeinschaftlich verarbeitet – vielmehr tragen alle ihre persönliche Last inklusive ihrer Trauer in einsamer Größe allein für sich. Selbst bei zumindest damals noch sozial extrem anstößigen Lebensumständen (Ehebruch, uneheliche Kinder, ihre Kinder verlassende Mütter, die Familie verlassende Männer) wird kein Moralisieren im bürgerlichen Sinn dargestellt. Im Vordergrund steht immer die konkrete Aufgabe, mit der gegebenen Situation in möglichst menschenwürdiger Weise umzugehen. Das selbstverständliche Annehmen schwieriger, auch tragischer Lebensumstände einschließlich aller damit verbundener Entsagungen zugunsten von als übergeordnet verstandener ethischer (moralischer) Werte, darunter auch die familiäre Gemeinschaft im erweiterten Sinn, hat einen hohen Stellenwert im Leben der Personen. Diese Werte werden niemals explizit proklamiert, um sie wird nicht rhetorisch gerungen: sie sind, was sie sind.
Die Orientierung der Autorin an der traditionellen Geschlechtsrollendichotomie ist nicht einfach konservativ, vielmehr versucht sie, die traditionelle Erstarrung dieser Rollenvorgaben aus sich heraus zu überwinden: sie so sehr mit individuellem Leben zu füllen, daß sie sich wandeln zu neuer zwischenmenschlicher Authentizität! Ihre Darstellung von sozialen Verhaltensweisen und Haltungen bei Frauen innerhalb der neuen Normalität in den 20er Jahren (Orientierung an sozialer Ungebundenheit und Freiheitlichkeit im äußeren Sinn, frauenrechtliche Intentionen, Frauenstudium u.dgl.) macht deutlich, daß sie diese Tendenzen eher als Flucht vor den Anstrengungen eines erfüllten Lebens deutet. – Darin allerdings steht Paula Bubers Buch diametral zur gesellschaftlichen Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
In vielen Facetten zeigt sich bei einzelnen Personen das Beharren auf individuellen Eigenheiten, Ideologemen, Idiosynkrasien, die von anderen Familienmitgliedern abgelehnt werden, wobei diese wiederum in anderen Aspekten ungewöhnlich sind. So ist es zwar auch bei uns, aber es zeigt sich meist weniger deutlich, weil heutzutage das allermeiste Abweichende reflexhaft kaschiert wird mit konsensuellen Meinungen oder Verhaltensweisen bzw. mit Rückzug. Bei Paula Buber zeigt sich das soziale Leben innerhalb des Familienverbandes als Geflecht von "Abweichungen" voneinander, die immer neu geklärt, harmonisiert oder bewußt ausgehalten werden. Trotz des Beharrens auf konventionellen Geschlechtsrollen sehe ich so, wie die Familie dies praktiziert, ein geringeres Maß an Entfremdung, als sich in unserer gesellschaftlichen Zwangsnormalität zeigt.
Die meisten innerhalb des Romans bedeutsamen Männer sind das, was die Autorin gerne "Sonderlinge" nennt: Menschen, die nach ihrem ganz eigenen und jeweils unterschiedlichen Lebensgesetz empfinden und handeln, weitgehend unabhängig von Verständnis oder Zustimmung der Außenwelt. Dabei orientiert sich ihr Leben durchaus an der traditionellen männlichen Rolle (Beruf und sonstige Aktivität in der Außenwelt, traditionelle und juristische Entscheidungsbefugnis in bestimmten Fragen), die aber nicht als schematisches Reproduzieren von gesellschaftlichen Vorgaben praktiziert wird. – Auch die bedeutsamen Frauen zeigen höchst individuelle Nuancen des Empfindens und sozialen Verhaltens innerhalb der traditionellen Frauenrolle (lieben, bewahren, sorgen, beheimaten, mitfühlen, weinen).
Paula Buber hat (zweifellos) lebenslang nach Möglichkeiten gesucht, authentische Mitmenschlichkeit anzunähern (in ihrem Leben und in der Literatur) auf Grundlage zivilisatorischer, kultureller Traditionen, jedoch in Abgrenzung zu statischen (d.h. strukturkonservativen) Aspekten dieser Zivilisation einerseits und andererseits zu den für sie unbegreiflichen, erschreckenden neuen Formen sozialen Lebens, die sie offenbar nur in ihren menschenunwürdigen Momenten erfahren hat. In diesem Ringen um etwas, das es kaum mehr gibt (oder das es vielleicht so nie gegeben hat), für dessen Wert sie aber einsteht mit ihrer ganzen Integrität, konnte ich ihr Buch immer wieder mit Adalbert Stifters Werk assoziieren. Durch seine monomane Stringenz wird AM LEBENDIGEN WASSER allerdings ein Buch für Wenige bleiben.
Alles in allem ein großartiges Buch, das in der Vielschichtigkeit seiner Bezüge und in seiner kompromißlosen Einseitigkeit fast einzigartig ist in der deutschen Literatur.
AM LEBENDIGEN WASSER wird hier erstmalig seit 1952 wiederveröffentlicht.
auc-182-paula-buber (pdf 2,7 MB)