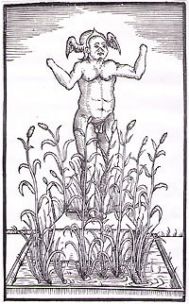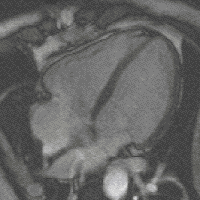Robert Musil: REISE INS PARADIES
Neu im August 2025
Zwanzig Kapitel aus dem Mann ohne Eigenschaften
Mitsamt Textentwürfen umfaßt der MoE mehr als 2000 Druckseiten. Wozu jetzt eine Veröffentlichung von 20 Kapiteln?
Ich sehe sämtliche Kapitel des Romans (unter einem Blickwinkel) als einzelne kleine Essays, in denen zwischenmenschliche Situationen (oder Reflexionsvorgänge einzelner Figuren) entfaltet werden. Sie alle stehen miteinander in untergründiger oder offensichtlicher Verbindung: in der erzählerischen Aufeinanderfolge des Romangeschehens wie auch in direkter Verbindung mit anderen Kapiteln. Alle Kapitel sind insofern kleine Systeme ("Dimensionen") , die mit anderen "Dimensionen"(des Buches) verbunden sind und verbunden werden: "(…) sie vermeinten, daß sie und ebenso die Dinge nicht mehr einander abwehrende und verdrängende, geschlossene Körper seien, sondern geöffnete und verbundene Formen."
"Es kommt auf die Struktur einer Dichtung heute mehr an als auf ihren Gang", schreibt Musil in einer Notiz. Gemeint ist zweifellos eine Struktur der Reflexion, der Gedanken. Solche sich aufeinander beziehende Gedanken und Blickpunkte lassen sich auch in den hier ausgewählten Kapiteln finden; beim Lesen ergeben sich dadurch neue Zusammenhänge, neue Aspekte oder Möglichkeiten von Wahrheit. Diese Umgangsweise ist in Musils Reflexion selbst schon vorgegeben.
Der MoE ist eigentlich eine Art Gedankenroman – Gedanken umspielen einander: so ist das eigentliche Geschehen. Ein Unisono vielstimmiger Gespräche, die im Fluß des Lebens an uns vorbeischwimmen; eine Zeitlang hören wir zu, denken mit .. dann kommt wieder etwas anderes. "Die Aufgabe ist: immer neue Lösungen, Zusammenhänge, Konstellationen, Variable zu entdecken, Prototypen von Geschehensabläufen hinzustellen, lockende Vorbilder, wie man Mensch sein kann, den inneren Menschen erfinden."
Die Texte dieses Romans transportieren eine glitzernde, schillernde Vielfalt poetischer (seelischer, spiritueller) Augen-Blicke, die ihre je eigene Bedeutung bewahren, ohne sich aufzulösen in der Handlung des jeweiligen Kapitels, zu dem sie gehören – oder gar in dem Roman als Ganzem.
Vielleicht ist es kein Sakrileg, mit der Lektüre des MoE (dieser Welt von Reflexion und Poesie) zu beginnen, wie wenn wir ein Puzzle aus seinen 5000 Teilen zusammensetzen wollen: mit beliebigen, spontan gewählten Stücken anzufangen: aufmerksam für Zusammenhänge, die sich uns öffnen!
Das Kapitel "Eine Reise ins Paradies" ist – für sich genommen, selbst in seiner frühen Konzeptfassung – große Literatur .. in seiner Innigkeit, Poesie und Ratlosigkeit, in seiner Tragik und dem Aufbegehren gegen verinnerlichte Normen. Der Text hat eine in sich geschlossene Gestalt. Sein Sinn liegt zunächst in dem, was dort entfaltet wird, – wobei sich aber vielleicht nur innerhalb einer aporetischen Beziehungskonstellation das Feuer der Notwendigkeit entzünden konnte:
"(…) wenn es der Sinn dieser Träume ist – und es könnte wohl sein, daß sie die letzte Erinnerung daran bedeuten –, daß unsre Begierde nicht verlangt, ein Mensch aus zweien zu werden, sondern im Gegenteil, unsrem Gefängnis, unsrer Einheit zu entrinnen, zwei zu werden in einer Vereinigung, aber lieber noch zwölf, tausend, unzählbar Viele, wie im Traum uns zu entschlüpfen, das Leben hundertgrädig gebaut zu trinken, uns entführt zu werden oder wie immer (…)."
Der Aporie einer essentiellen, existentiellen ("ekstatischen") Verbindung zwischen der menschlichen Identität ("Ich") und allem Nicht-Ich (Natur, Welt) versucht Musil sich anzunähern durch die Parabel von der unbedingten Liebe zwischen Zwillingsgeschwistern: die aus einer ursprünglichen Verbindung stammen, jedoch andererseits füreinander "Nicht-Ich" sind. – Die konventionelle "Inzest"-Problematik lenkt von diesem tiefgründigeren Zusammenhang meiner Meinung nach eher ab.
(Aus dem Nachwort)
auc196-musil-reise (pdf 2,5 MB)